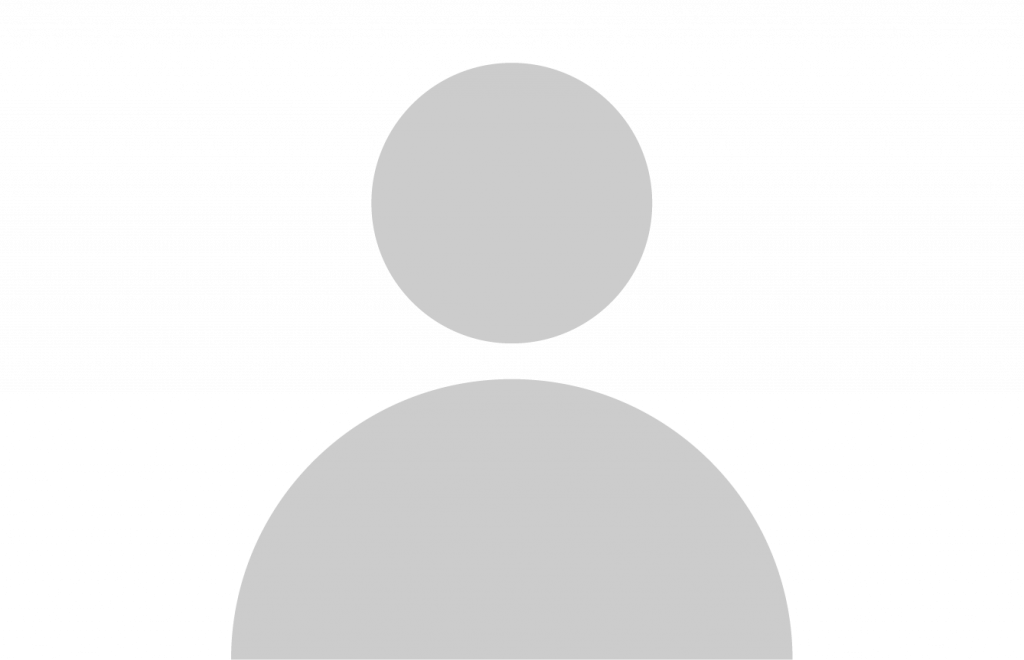Sebastian B., Streetworker
Studienabschluss: Soziale Arbeit, B.A.
Ich bin 33 Jahre alt und arbeite in der akzeptierenden Drogenhilfe. Schwerpunktthema ist Gesundheitsförderung im Allgemeinen und Infektionsprophylaxe (HIV und Hepatitis B/C) im speziellen. Die Primärzielgruppe sind Drogengebraucher/innen die injizierbare Substanzen konsumieren (Opioide, Kokain u.ä.).
Ich leiste aufsuchende Soziale Arbeit an Szenetreffpunkten. Dies geschieht in der Regel mobilgestützt, sprich, mit umgebauten Campingmobilien aber auch zu Fuß (klassische Streetworktätigkeit). Ich berate zu Themen wie HIV und Hepatitis sowie rund um den Substanzkonsum.
Die Vergabe von sterilen Konsumutensilien (wie Spritzen, Nadeln u.ä.) gehört ebenso zu meinem Tätigkeitsfeld, wie die Beratung zu weniger riskanten Konsumformen (rauchen oder „sniefen“). Diese Tätigkeit lässt sich mit Safer Use zusammenfassen. Ein weiteres Tätigkeitsfeld ist die gemeinwesenbezogene Sozialarbeit.
Mein Arbeitsbeginn kann variieren, da genieße ich relative Flexibilität. Allerdings fange ich gerne früh an. Gestartet wird mit Büroarbeit, Mails beantworten, Papierkram etc. Zudem sind morgens regelmäßig Teamsitzungen. In der Regel fahre ich dann nachmittags mit dem Mobil und eine/r Kollege/in sowie einer Unterstützungskraft (z.B. Praktikant/in) mit dem Mobil raus auf die Szene.
Dort stehen wir nicht alleine. Ein Gesundheitsmobil ist ebenfalls dabei. Wir arbeiten in einem interdisziplinären Team (Pflege/Soziale Arbeit). Ich bin ca. zweimal die Woche „auf der Straße“. Zudem nehme ich Außentermine wahr. Das können Schulungen, Informationsveranstaltungen, Gremien u.ä. sein. Oft mache ich auch reine Bürotage.
Wenn ich ehrlich bin, mein Abschluss hat nichts anderes hergegeben (Fachhochschulreife Sozialarbeit/Sozialpädagogik). Es war keine Liebeshochzeit.
Im Nachhinein muss ich sagen, ich hatte unverschämtes Glück. Als das Semesterpraktikum vor der Tür stand, war ich ein bisschen ratlos. Ich hatte nicht viele Ideen. Ich wollte niedrigschwellig arbeiten, wollte das Kontrollmandat in meinem Praktikum möglichst vermeiden. Also habe ich mich bei meinem jetzigen Arbeitgeber beworben und ich bekam eine Zusage. Sieben Jahre später bin ich immer noch da.
Ein elementarer Vorteil an der niedrigschwelligen, akzeptierenden Sozialarbeit ist, dass das Kontrollmandat fast gänzlich wegfällt. Du musst wenige verbindliche Termine machen, die Leute nicht sanktionieren.
Zudem arbeiten wir bedarfsorientiert; es geschieht nichts, was die Besucher/innen unserer Angebote nicht wollen. Das ist eine Voraussetzung für eine vertrauensvolle Arbeit auf Augenhöhe, die in anderen Arbeitsfeldern so nicht gegeben ist. Auf der Straße bist du im Wohnzimmer der Szene, das ist ein ganz anderes Setting, als wenn du dir Klient/innen in dein Büro einlädst.
Eine zentrale Schwierigkeit und Herausforderung besteht darin, Lücken des (Sucht-)Hilfesystems mit kreativen Lösungen zu kompensieren. Vielen Menschen unserer Zielgruppe haben keinen oder nur eingeschränkten Zugang zu den Hilfesystemen oder dieser ist fast immer zu hochschwellig. Es ist immer wieder eine Herausforderung, bedarfsorientiert Lösungen bzw. Lösungsoptionen aufzuzeigen bzw. zu realisieren.
Das ist wirklich schwer zu beantworten. Mein Studium ist schon eine Weile her. Was auf jeden Fall hilfreich ist, sind die umfangreichen Kenntnisse in der Bezugswissenschaft Recht. Das Sozialgesetzbuch ist allgegenwärtig. Einen groben Überblick über die Methodologie der Sozialen Arbeit zu bekommen, hat bestimmt auch nicht geschadet.
Die Rechtsvorlesungen bei den beiden Rechtsprofessoren.
Grundvoraussetzung ist Empathie für die Zielgruppe, etwas, was man schwer im Studium lernen kann. Wichtig ist Rollenverständnis und Grenzziehung (professionelles Verhältnis von Nähe und Distanz) sowie die Fähigkeit des Perspektivwechsels in der Arbeit mit Klient/innen oder Besucher/innen im Studium zu erwerben.
Dazu gehört, eigene Werturteile hinten anzustellen zu können und Verständnis für Lebensentwürfe, vielleicht fernab der eigenen, zu entwickeln. Die/der Klient/in als Experten für sich selbst wahrzunehmen.
Das sind alles Themen, die im Studium eine Rolle spielen sollten. Im Falle meines spezifischen Berufsfeldes sind Kenntnisse über Wirkungsweisen von Substanzen sowie HIV und Hepatitiden von Vorteil. Die letztgenannten Themenfelder sollten durch Zusatzqualifikationen oder trägerintern vermittelt werden, da sehe ich nicht unbedingt die Fachhochschulen in der Pflicht.
Vor dem Hintergrund, dass im Kolloquium vieler Hochschulen die Drogen- und Suchthilfe oft nicht besonders prominent vertreten ist, empfehle ich, ehrenamtlich im Feld Erfahrungen zu sammeln. In der praktischen Arbeit erlangt man erste, wichtige Einblicke. Sollte sich ein langfristiges Interesse entwickeln, ist es vielleicht lohnend sich für spezifische Seminare bei den verantwortlichen Stellen der FH einzusetzen sowie das Semesterpraktikum dementsprechend zu wählen.